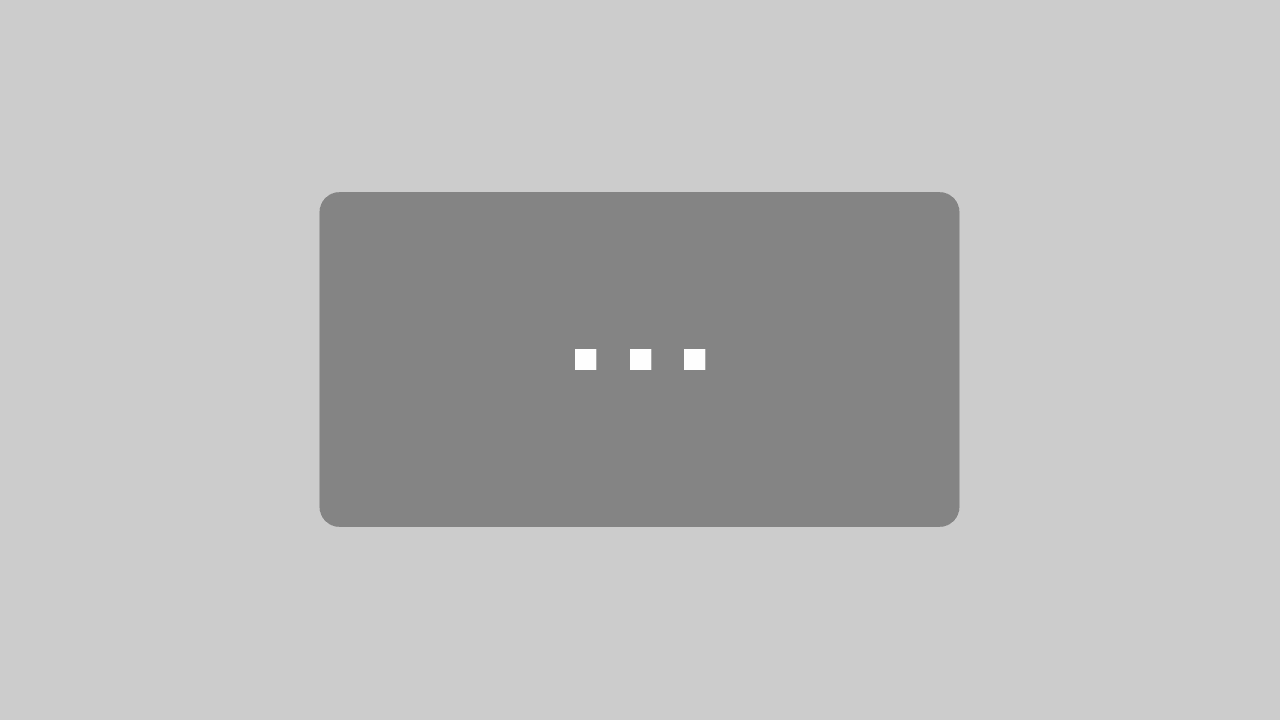Auf Frauen bauen by Martin Tschechne | 8. März 2019 | Personalities
Seit 1979 wird der Pritzker-Preis an die weltbesten Architekten verliehen. Stifter sind der US-Unternehmer Jay A. Pritzker und seine Frau Cindy. In der Regel geht die Auszeichnung an einen Preisträger, es kommt auch vor, dass sie geteilt oder an ein Team vergeben wird. Sie ist dotiert mit 100.000 US-Dollar, noch mehr aber zählt die Ehre. Der Pritzker-Preis ist der Nobelpreis der Architektur. 45 große, großartige Architekten sind bisher mit ihm geehrt worden. Drei von ihnen waren Frauen. Leider wahr: drei Frauen gegenüber 42 Männern.
1991 wurde der renommierte Preis an Robert Venturi verliehen, den strengen Denker und Planer der Postmoderne, Erbauer des Sainsbury Wing an der National Gallery in London und des Seattle Art Museum an der amerikanischen Westküste. Wer auf der Bühne fehlte, war Denise Scott Brown, seine Ehefrau.
Dabei führte das Paar ein gemeinsames Büro, sie entwickelten ihre Projekte in enger Kooperation, in den Büchern zu den Grundlagen ihrer Architektur traten beide als Autoren auf. Und sie war es gewesen – die in Südafrika geborene, in England und den USA ausgebildete Architektin und Stadtplanerin –, die den strengen, aus der Architekturtheorie und -geschichte hergeleiteten Konzepten ihres Partners eine ganz eigene Perspektive eröffnete. In Las Vegas etwa hatte sie Einkaufsstraßen, Parkplätze und unzählige Werbetafeln fotografiert – und aus den Erscheinungsformen dieser Nicht-Architektur hergeleitet, dass es auch in den eigenen Projekten Begegnung ist, auf die es ankommt, Austausch und Kommunikation. Und so arbeitete auch ihr Büro: als Gemeinschaft, in der unterschiedliche Positionen zusammenfließen. Wer am Ende genau was beigesteuert hatte? Nicht mal das Architektenpaar selbst konnte es sicher sagen.
Den Pritzker-Preis bekam er ganz allein. Die beiden nahmen es hin, wider besseres Wissen, weil das Komitee nicht mit sich reden ließ. Und weil ihr Büro damals ein bisschen Aufwind gut gebrauchen konnte. Erst 22 Jahre später, 2013, forderte die Initiative „Women in Design“ an der Harvard University, rückwirkend auch die Ehefrau auszuzeichnen. 20.822 Unterstützer hatten die Petition unterschrieben, auch Venturi selbst. Half aber alles nichts. Jetzt honoriert eine Ausstellung im Architekturzentrum Wien endlich ihren Anteil am gemeinsamen Lebenswerk: „Downtown Denise Scott Brown“ läuft dort bis zum 18. März 2019. Ob es ihr, ein Jahr nach dem Tod des Ehemanns, ein Trost ist? Die Architektin, 87 Jahre alt, wird es nicht verraten. Für sie ist Bescheidenheit eine wichtige Tugend ihres Berufsstands. Nicht oft zu finden.
Bauen Architektinnen anders als Architekten? Gehen sie andere Wege und erzielen dadurch andere Resultate? Hätte ein Mann einen so beschwingten, beinahe poetisch leichten Wolkenkratzer in die Innenstadt von Chicago zaubern können, wie es Jeanne Gang mit ihrem 82 Stockwerke hohen „Aqua Tower“ getan hat? Braucht es ein speziell weibliches Netz von Gedankenverbindungen, um ein Bürozentrum als Inkubator zu konzipieren, als einen wärmenden Brutkasten für Ideen, wie ihn Odile Decq mit ihrem „Le Cargo“ in Paris gebaut hat? Und ist die spektakuläre High Line in New York nur denkbar als das Werk einer Frau? Elizabeth Diller hat die stillgelegte und von Stelzen getragene Bahntrasse zu einer lang gezogenen Grünfläche ausgebaut, einer Oase der Entspannung hoch über dem Gewühl der Straßen an der Westseite von Manhattan.
Oder sind solche Fragen so unsinnig wie die, ob Männer besser kochen können – weil doch die meisten Spitzenköche Männer sind? Ob der Pritzker-Preis nach einer Quote verliehen werden sollte? Oder ob eine Auszeichnung speziell für Architektinnen hilfreich wäre, ein Gefälle auszugleichen, dessen Ursachen mit dem Bauen nur in letzter Konsequenz zu tun haben? Wer ein Mann ist, nähert sich hier besser in Frageform.
In den USA sind die Hälfte aller Studierenden im Fach Architektur Frauen; unter denen, die den Beruf dann auch ausüben, ist es gerade noch ein Sechstel. In anderen Berufsfeldern, Medizin oder Jura, ist das Verhältnis immer noch schief, aber weit weniger krass: Dort verschiebt sich die Verteilung nach dem Examen auf ein Verhältnis von etwa einem Drittel zu zweien. Ist Architektur also besonders frauenfeindlich? Architektinnen in Deutschland, so ermittelte die Hans-Böckler-Stiftung, verdienen 17 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Nach 20 Jahren und mehr im Beruf, so das „Deutsche Architektenblatt“, beträgt die Differenz im Durchschnitt 11.700 Euro pro Jahr.
Elizabeth Diller arbeitet im Team mit zwei Männern, Diller, Scofidio + Renfro; ihre Bauten muten kühn und visionär an, rebellisch, zart und voller Ungeduld. Kampfansagen an alles Biedere und Verzagte, Projektionen in eine Zukunft aus Hightech und Ökologie. Der Sarjadje-Park neben dem Kreml, der geplante Erweiterungsbau für das MoMA, die riesige Glashaube des Kulturzentrums „The Shed“ in New York – Raumstationen, die dem Publikum den Atem verschlagen, umstritten, weil die Architekten es genau darauf anlegen: Streit. Aufrütteln. Staunen. Auch die High Line war ein Zankapfel. Bevor die Leute ihren Park auf Stelzen ins Herz schlossen. Gerade wurde Diller vom „Time Magazine“ zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2018 gewählt. Als einzige Vertreterin ihrer Zunft. Kein männlicher Architekt steht auf der Liste.
Die Japanerin Kazuyo Sejima hat einen Pritzker-Preis bekommen, 2010, gemeinsam mit ihrem Partner Ryue Nishizawa, männlich, zehn Jahre jünger als sie, früher ihr Angestellter. „She’s the boss“, sagt er gern. Er ist ein verschmitzter Typ. Beide betreiben neben dem gemeinsamen Büro SANAA in Tokio noch je ein eigenes Studio. Das Hokusai Museum in Tokio hat sie gebaut, das Museum auf der Insel Teshima er. Das Museum für Kunst des 21. Jahrhunderts in Kanazawa haben sie gemeinsam geplant: ein riesiger, mit Glas eingefasster Zirkel, aus dem die Schausäle wie Klötze herausragen. Es fällt schwer, die Arbeiten auseinanderzuhalten. Weich und rund ist eher seine Linie, ihre ist zackig und kühn.
„Wir danken es der #MeToo-Bewegung“, sagte Amanda Levete, als sie im vergangenen März den Jane Drew Preis für Architektinnen überreicht bekam. Jane Drew war eine Pionierin der Moderne in Großbritannien, in den 1950er-Jahren hatte sie gemeinsam mit Le Corbusier und Pierre Jeanneret die indische Planstadt Chandigarh gebaut. Auch eine Pionierin ihres Berufsstands – und Levete führte es auf die Beharrlichkeit der Frauenbewegung zurück, dass sie heute die Freiheit hat, immer wieder neue und spannende Projekte auch im Wettbewerb gegen männliche Konkurrenz zu erobern. Die Fronten sind nicht mehr so starr, wie sie es waren. Amanda Levete konnte sich als Star-Architektin etablieren. Und ihre spektakulären, weit und mutig ausgeschwungenen Bauten wie der Anbau des Victoria and Albert Museums in London oder das Kunst- und Technologiezentrum MAAT in Lissabon wirken fast, als wollte sie ein Dankeschön formulieren.
Vielleicht war Zaha Hadid die wahre Pionierin einer weiblichen Architektur wie auch für die Frauen in ihrem Beruf. Lange galt die im Irak geborene Britin als eine, die Ideen von einzigartiger Kühnheit entwickelte, aber nicht baute. Als sie dann 1993 mit dem wild gezackten Feuerwehrhaus der Firma Vitra in Weil am Rhein loslegte, schoss sie wie ein Pfeil an die Spitze. Dorthin, wo niemand mehr nach dem Geschlecht fragt. 2004 war sie die erste Frau, die mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde. Ihre Bauten dulden keine Einwände, sie sind Sensationen aus Masse und Schwerelosigkeit: die Sprungschanze auf dem Bergisel in Innsbruck, das Experimentiermuseum „phæno“ in Wolfsburg, der „Innovation Tower“ in Hongkong oder die Oper im chinesischen Guangzhou.
Gibt es eine weibliche Architektur überhaupt? Unterscheidet sie sich von einer männlichen durch ihre Absichten? Ihre Dimension? Nimmt sie mehr Rücksicht? Wenn es so einfach wäre! Die Wienerin Margarete Schütte-Lihotzky, im Jahr 2000 gestorben im Alter von 102 Jahren, verewigte sich mit der „Frankfurter Küche“. Sie hatte alle Wirren eines Jahrhunderts erlebt und durchlitten, den Stalinismus, die Diktatur der Nazis. Eine Küche, in der die Arbeitswege wissenschaftlich analysiert und effizienter gestaltet werden, mag da wie eine karge Geste erscheinen. Aber sie hat Millionen von Menschen den Alltag erleichtert; die meisten waren wohl Frauen. Die nach Brasilien ausgewanderte Italienerin Lina Bo Bardi rettete eine verfallende Fabrik für Ölfässer und baute daraus ein Zentrum für Kultur, Sport und Sozialarbeit, das „SESC Pompéia“. Für einen Ort wie São Paulo ein Segen.
Retten, bewahren, beschützen, helfen: Beschreiben andere Verben die Arbeit von Architektinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen? Eileen Gray baute sich ein verzaubertes Liebesnest, die „Villa E-1027“, an einen grünen Hang über die französische Riviera am Cap Martin, hochelegant, ausgestattet mit den Möbeln der genialen Designerin, später noch veredelt durch Wandmalereien von Le Corbusier. Susana Torre entwarf ein Refugium an der spanischen Küste bei Carboneras – doch ebenso wichtig wie der Blick aufs Meer war der Amerikanerin der intellektuelle Reiz, die Proportionen des Komplexes aus sieben Wohnungen zu perfekter Harmonie zu arrangieren: Schönheit ergibt sich aus Funktion und Mathematik. Für die Architektur gilt das seit uralten Zeiten.
Vielleicht ist die Suche nach Unterschieden Zeitverschwendung. Gute Architektur ist gute Architektur und fertig. Die Katalanin Carme Pigem wurde 2017 mit ihrer Gemeinschaft RCR Arquitectes als dritte Frau mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet. Sie selbst und zwei Männer. Ja, es gab schon Duos unter den Preisträgern, etwa Herzog & de Meuron oder SANAA. Aber erst ein Trio repräsentiert, was heute in der Architektur geboten und längst üblich ist: Teamarbeit. Die Wette gilt: Kein Haus geht inniger auf das Werk eines Künstlers ein als das gemeinsam entworfene Museum für den Maler Pierre Soulages im französischen Rodez.
Und Pigems Landsmännin – doch, das Wort steht wirklich so im Duden – Carme Pinós stand kürzlich auf einer Bühne in Hamburg und erzählte von einem Lebensweg, der in seinen Wendungen dann doch sehr weiblich war: Lauter Brüder habe sie gehabt und einen Vater, der schier daran verzweifelte, den alten Hof der Familie instand zu halten. Aber keiner der Söhne habe sich zum Bauen berufen gefühlt, sagte die spätere Architektin so spektakulärer Bauten wie des Caixa-Kulturforums im nordspanischen Saragossa, des jüngsten „MPavilion“ im Queen Victoria Park in Melbourne oder der kühnen Bürotürme „Cube I“ und „Cube II“ im mexikanischen Guadalajara. Na schön, da habe sie sich eben auf den Weg gemacht.