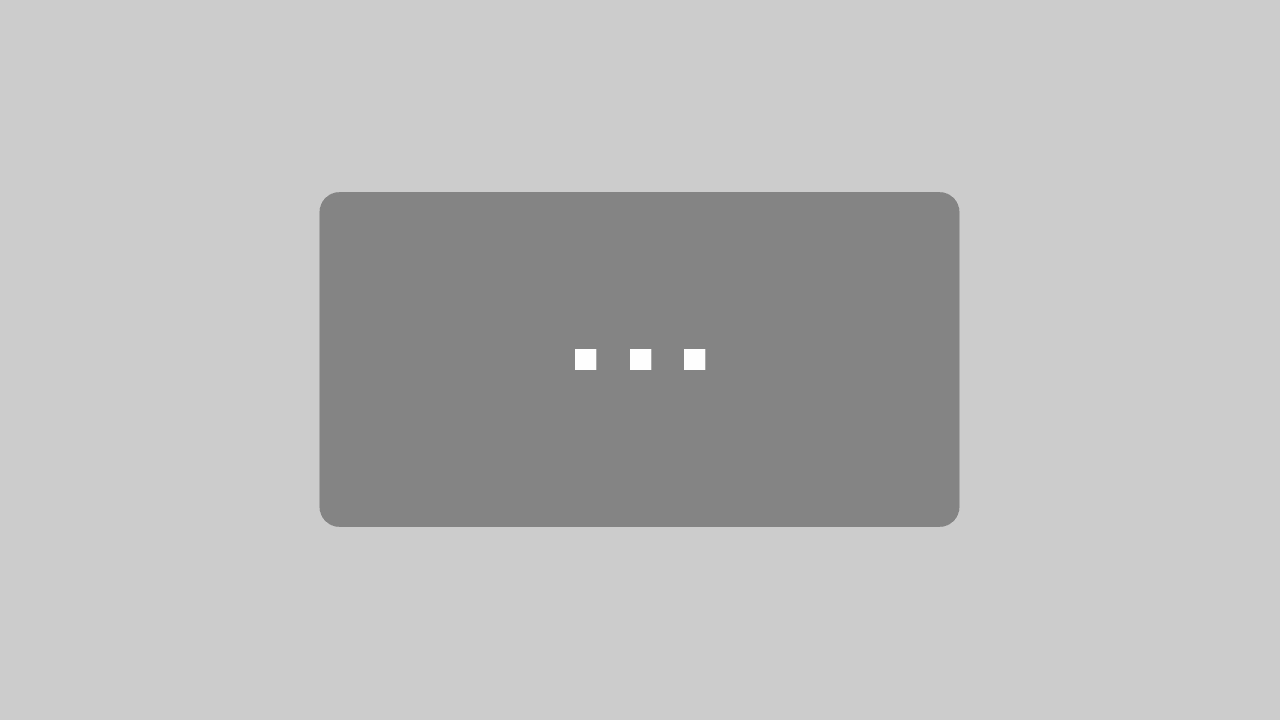Tracey Emin by Martin Tschechne | 5. März 2021 | Personalities
Tracey Emin gilt mit ihrer provozierenden Persönlichkeit als eine der größten lebenden Künstlerinnen. Seit ihrer Krebsdiagnose scheint es, als habe die Engländerin Frieden mit sich geschlossen. Ihr letzter Akt ist auch ihr glücklichster.
Aus ihren Gefühlen hat Tracey Emin nie einen Hehl gemacht. Ihre öffentlich ausgelebte, oft exzessive Sexualität schockierte das Publikum, und genau so sollte es sein. Was sie damit erreichte, ist die Freiheit, sich nun – kurz vor 60 – als eine ganz andere, ernsthafte Künstlerin zu präsentieren: abgeklärt und reflektiert, selbstsicher, kritisch und unabhängig genug, sich zu ihren großen Vorbildern aus der Kunstgeschichte zu bekennen.
Kann sein, dass Roberto sich geschmeichelt fühlte. Und John, Frank, Chris und Suleman: Oder hat es sie befremdet, sich unter so vielen wiederzufinden? Bestimmt gab es den einen oder anderen, der sich vor aller Öffentlichkeit bloßgestellt sah. Welche andere Frau führt schon eine erschöpfend detaillierte Liste darüber, mit wem sie geschlafen hat? Und welche stichelt jeden Namen als Patchwork, knallbunt und übergro., auf die Innenwand eines Zeltes? Tracey Emin hat es getan. Die Engländerin, aufgewachsen in Margate, einem schon damals abgehängten Seebad an der britischen Ostküste, betrat die Szene der jungen Kunst in London als Unbekannte aus der Provinz. Hübsch, aber auch ein bisschen ordinär, Schulabbrecherin mit Modediplom, neugierig, verunsichert, verwegen. Und schwer traumatisiert: zwei Vergewaltigungen als Teenager, die erste Abtreibung mit 20.
Der Titel ihrer Zelt-Installation „Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995“ relativiert das, scheint alles in einen Topf zu rühren: Liebe, Gewalt, Zärtlichkeit, die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Verzweiflung. Die Angabe des Zeitraums nämlich gehört unbedingt dazu. Er umfasste damals ihr gesamtes Leben, von der Geburt bis zur Gegenwart. Also stand im Gewirr der 102 Namen auch die Großmutter, in deren Armen sie als Säugling geschlummert hatte. Und irgendwo zwei namenlose Föten. Das Spiel mit Sprache kann brutal in die Irre führen.
Der Auftritt war ihr Durchbruch. Tracey Emin, die Trotzige, wurde ein Star. Hübsch, auch ein bisschen ordinär, neugierig, verunsichert, verwegen.
Volle Absicht. Die Geschichte des Zeltes erzählt eine Menge auch über die Tracey Emin von 1995 und danach. Angekommen in der Metropole London, bald auch geadelt durch ein Diplom des Royal College of Art, aber noch lange so etwas wie das Mauerblümchen unter den schon durch ihre Skandale etablierten Künstlern der Young British Artists, Damien Hirst, Chris Ofili oder Sarah Lucas. Sie möge nach all ihren kleinformatigen Papierarbeiten etwas Großes zeigen, riet der Kurator Carl Freedman, als er sie zur Ausstellung „Minky Manky“ in der South London Gallery einlud. Die Künstlerin reagierte zornig auf die kaum verhohlene Kritik: etwas Großes? Spektakuläres? Bitte sehr! Und die Kritik applaudierte: Der Auftritt war ihr Durchbruch. Tracey Emin, die Trotzige, wurde ein Star. Auch der Name des Ausstellungsmachers war in die Zeltwand gestickt.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Charles Saatchi bot 12.000 Pfund für das Zelt, Emin wies ihn ab. Ein Werbemensch, der in seinen Kampagnen Margaret Thatcher unterstützt? No way! Der Sammler musste warten, bis ein Galerist das Skandalwerk anbot. Zahlte nun also 40.000 Pfund und schickte das Zelt auf Reisen, in die spektakuläre „Sensation“-Schau der Royal Academy, bald auch nach New York. Ein paar Jahre später soll ein Konkurrent ihm 300.000 Pfund offeriert haben, vergeblich. Und wiederum ein paar Jahre später, 2004, wurde das zur Ikone aufgestiegene Werk beim Brand eines Lagerhauses vernichtet.
Die Presse beklagte unersetzlichen Verlust; Saatchi lockte die Künstlerin mit einer Million, wenn sie das Zelt rekonstruiere. Sie tat es nicht. Kunst hat ihre Grenzen. Woher auch sollte sie die Stoffreste nehmen, die alle ihre eigene Geschichte und Bedeutung hatten? Der Kollege Stuart Semple fegte noch die Aschereste ihrer Arbeit zusammen, um sie als vorgefundene Stücke, als Objets trouvés in Plexiglas zu verkaufen. So lief das auf dem Markt. Die inzwischen sehr hoch gehandelten Vertreter der jungen britischen Kunst hatten ihre Lektionen gelernt. Nur Tracey Emin reagierte stoisch. Im Irak würden Hochzeitsfeiern bombardiert, wandte sie ein, man möge bitte auf dem Teppich bleiben.
Inzwischen hatte sie längst die zweite Ikone ihrer Zeit platziert, zunächst in einer Ausstellung in Tokio – und gegen die Installation „My Bed“ von 1998 wirkte das drei Jahre ältere Zelt nur noch wie eine pubertäre Provokation: Zerwühlt und dreckig marschiert das Schlafmöbel seither durch Museen und Galerien auf der ganzen Welt, verschmiert mit Blut und Sperma, zugemüllt mit getragener Unterwäsche, Zigarettenkippen, gebrauchten Kondomen, Tampons, Antibabypillen und halbleeren Wodkaflaschen. Was waren das für irre und böse, hysterische Zeiten! Bis der Sammler Saatchi neue Helden entdeckt hatte, diesmal figurative Maler von Martin Kippenberger bis zur Neuen Leipziger Schule, und der Kunstmarkt ihm folgte, bereitwillig wie immer.
Tracey Emin war eine von nicht vielen, die den raschen Wandel in der Gunst des Publikums überlebten. 2007 wurde sie mit dem Auftrag geehrt, den offiziellen Pavillon Großbritanniens auf der Biennale von Venedig zu gestalten; seit 2011 lehrt sie als Professorin für Zeichnung an der Königlichen Kunstakademie in London, eine von nur zwei Frauen – neben Fiona Rae – in der mehr als 250 Jahre langen Geschichte der Institution. Sie gehört, keine Frage, zu den renommiertesten Künstlerinnen ihres Landes. Nennt sich eine Feministin, aber weist es von sich, als feministische Künstlerin bezeichnet zu werden. Kunst ist Kunst, und der Rest ist der Rest. Das Bett, nebenbei, wurde inzwischen für 2,5 Millionen Pfund versteigert.
Das wilde, geschlagene und oft selbst gewalttätige Mädchen existiert nicht mehr.
Denn da war immer auch eine andere Tracey Emin gewesen. Sie habe nichts mehr mit der jungen Frau von damals gemein, konstatierte die Künstlerin schon vor einigen Jahren. Sie habe sich von ihr gelöst und sei in einer neuen Lebensphase angekommen, künstlerisch, menschlich und moralisch. Nicht ganz einfach, zu einem Frühwerk auf Distanz zu gehen, das so unmittelbar und so intim war. Doch Emin kriegt das hin: Das wilde, geschlagene und oft selbst gewalttätige Mädchen existiert nicht mehr. Das Leben gibt neue Rollen vor, manche verstärkt durch die Einsicht, nach all den wilden Zeiten doch immer intensiver allein zu sein.
Demütig sei sie geworden, einfühlsam, ehrlich gegen sich selbst und ganz allgemein: tolerant gegenüber Zweifeln und Schwäche. Die Aggressivität, die es brauchte, all die Namen von Männern und Frauen und sogar Ungeborenen auf einer Zeltwand ins Museum und an die Öffentlichkeit zu zerren – soll das wirklich sie gewesen sein? Heute undenkbar!
Damals hat sie um sich geschlagen, zornig, verletzt und beleidigt, zusätzlich wohl auch befeuert durch den Ehrgeiz, es den anderen gleichzutun, meist waren es ja Männer, die mit einem Haifisch in Formaldehyd oder Malerei auf Elefantendung Furore machten. Und Kasse. Ihr noch immer provozierendes Bett, so erzählte sie einmal in einem Interview, habe sie seit dessen Einzug in die reinweiße Welt der Kunst nicht mehr benutzt. Und fügte noch sehr offen hinzu, seit Jahren keinen Sex mehr zu haben. Hochprozentigen Alkohol habe sie ohnehin nie getrunken. Zigaretten rührt sie auch nicht mehr an. Das Kloster ruft, so beschrieb sie schon vor 15 Jahren ihren Alltag.
Alles Fiktion also? Unreifes, rücksichtsloses Gerangel um die besten Plätze auf einem Markt, der einfach alles teuer bezahlt, sobald nur der Name Saatchi draufsteht oder das Markenzeichen YBA für die junge Kunst aus Großbritannien? Tracey Emin entzieht sich allzu peinlicher Erinnerung. Immerhin kann sie auf ein solides Fundament verweisen, auf eine – von Ausreißern abgesehen – konsequente Künstlerbiografie und auf ein paar in langen Jahren respektvoll gepflegte Wahlverwandtschaften. Der Wiener Egon Schiele mit seinen schonungslosen Körperbildern gehört dazu, der expressive Menschenmaler Francis Bacon, die amerikanische Bildhauerin Louise Bourgeois, deren Vorstöße in die Tiefen der eigenen Traumata sie noch persönlich miterlebt hat. Oder der Maler William Turner, der große Pionier der Romantik.
An der Royal Academy durfte sie im vergangenen November eine künstlerische Begegnung zelebrieren, auf die sie sich lange vorbereitet hatte. Die Doppelausstellung „The Loneliness of the Soul“ mit den Arbeiten des Norwegers Edvard Munch war zunächst für Oslo vorgesehen; Emin hatte geplant, neben ganz neuen, oft großformatigen Gemälden eine überlebensgro.e Nackte aus Bronze mitzubringen, eine sieben Meter hohe, kniende „Mutter“ zur Eröffnung des neuen, funkelnden, vom Osloer Architekturbüro Snøhetta an die Wasserfront gebauten Munchmuseet.
Sie habe den übersensiblen, Zeit seines Lebens von Frauen verängstigten Maler schon als junges Mädchen geliebt, gesteht die Künstlerin. Und erläutert sehr deutlich: ihn als Mann attraktiv gefunden. Dann durchkreuzte Corona alle Reisepläne. Vorerst demonstriert sie bis Ende Februar in ihrer eigenen Heimat, wie die Arbeit des scheuen Norwegers ihre Auseinandersetzung mit der Sinnlichkeit des Malens geprägt hat. Und spricht dabei von Hingabe an das Material, an den Zufall, von der körperlichen Qualität des Malakts, vom Treibenlassen, vom Schweben. Und sie wäre nicht Tracey Emin, wenn sie nicht noch hinzufügte, diese Art der Malerei, nun ja, sei eigentlich wie Sex.
Im vergangenen Jahr, so erzählt Emin, habe sie ein solches sinnliches und zugleich verstörendes Gemälde in Blutrot und Schwarz aus sich herausfließen lassen. Getrieben, ohne Plan und Ziel. Kurz darauf entdeckten die Ärzte den Tumor in ihrem Unterleib. Zwölf Chirurgen brauchten im vergangenen Sommer sechs Stunden, um alles zu entfernen, den Uterus, die Blase, die Ovarien, Teile des Dickdarms, Teile der Vagina – die Künstlerin hat ihrem Publikum noch nie ein Detail erspart. Und der Tumor habe exakt die gleiche Form gehabt wie das amorphe Gebilde, das ihr Hand und Pinsel zuvor auf die Leinwand gezwungen hatten.
Es kann also sein, dass dieser Text schon sehr bald ein Nachruf ist. Doch sie sei glücklich, sagt Tracey Emin. Wirklich glücklich. Ihre Kunst füllt sie aus. Und es könne noch lange so weitergehen. Ihrem Leben hatte sie schon vor der Diagnose eine neue Richtung gegeben, hat sich noch mehr nach innen gewandt. Und sie ist in ihre Heimatstadt Margate mit dem unvergleichlichen Küstenlicht gezogen. Das Gebäude soll eines Tages ihr Archiv und ihr Museum beherbergen.